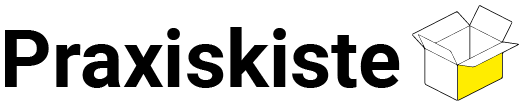Chancen erkennen, Potentiale entfalten
Im Bereich der Frühförderung werden Kinder von null bis sechs Jahren in ihrer Entwicklung unterstützt und gefördert. Der Bereich ist für viele, auch soziale Berufsgruppen interessant und bietet eine hohe Sinnhaftigkeit. Anke Kadereit gewährt uns in diesem Interview einen Einblick in dieses Arbeitsfeld und das Vorgehen mit den Klienten. Ein Interview von Jule Warta
Praxiskiste: Was ist es, das den Job in der Frühförderung für dich so besonders macht?
Anke Kadereit: Ich finde, dass es eine Arbeit ist, die eine hohe Sinnhaftigkeit hat. Und das ist, glaube ich, was sie auch für jüngere Mitarbeiterinnen attraktiv macht. Man hat das Gefühl, etwas bewirken zu können, man sieht Veränderungen und Entwicklungen beim Kind. Mich persönlich – als Psychologin, die auch viel mit den Eltern arbeitet – freut es, wenn diese neue Sichtweisen zu ihrem Kind entwickeln oder wenn sie sich an einer Entwicklung von ihrem Kind freuen. Es ist eine schöne Aufgabe, das zu begleiten und zu unterstützen.

Praxiskiste: Welche Angebote werden im Rahmen der Frühförderung umgesetzt?
Anke Kadereit: Grundsätzlich ist die Frühförderung modulartig aufgebaut. Das halte ich nach wie vor für ein total gutes System. Es gibt das offenes Beratungsangebot, bei dem die Eltern beraten werden zu dem, was die Frühförderung für ihr Kind, mit Blick auf dessen Entwicklungsverzögerung, anbieten könnte. Es kann bei diesem einen Termin bleiben und man empfiehlt irgendetwas oder es geht weiter im System.
Praxiskiste: Was wäre dann der weitere Verlauf?
Anke Kadereit: Der zweite Schritt ist eine Entwicklungsdiagnostik zu machen und festzustellen, ob das Kind einen Bedarf hat. Dann spricht man wieder mit den Eltern und sagt, was vorstellbar wäre. Es gibt immer die sogenannte Komplexleistung, also eine Kombination aus einer heilpädagogischen Förderung und einer medizinisch-therapeutischen Förderung: Ergotherapie, Logopädie oder Physiotherapie. Alle sollen sich untereinander absprechen und gegenseitig ergänzen.
Praxiskiste: Wo und wie arbeiten die Mitarbeitenden mit den Kindern?
Anke Kadereit: Innerhalb dieser Angebote kann man mit den Kindern zum Beispiel Gruppenangebote oder Kleingruppenangebote machen sowie in der Kita, zu Hause bei den Eltern oder in unserer Einrichtung arbeiten. Man kann auch eher an den Funktionen oder an den Ressourcen orientiert arbeiten, je nachdem, wie man ausgerichtet ist. Da gibt es schon relativ großen Spielraum.
Praxiskiste: Werden SozialarbeiterInnen in der Frühförderung gebraucht? Und wenn ja, was ist ihre Aufgabe?
Anke Kadereit: Wir hatten immer viele Sozialpädagogen, die neben der Zusammenarbeit mit den Eltern viel heilpädagogische Förderung gemacht haben, also die individuelle Förderung der Kinder über das Spiel. Außerdem gibt es noch ein Spezialgebiet, das ziemlich wichtig ist: die sozialrechtliche Beratung. Es ist gut, wenn das in jeder Frühförderstelle jemand kann, denn man muss sehen, ob die Familien alles beieinanderhaben: ihren Pflegegrad und Schwerbehindertenausweis. Was noch dazukommt ist die Beratung in Kitas zur Integration und Teilhabe.
Praxiskiste: Gibt es speziell für angehende SozialarbeiterInnen irgendetwas in diesem Arbeitsfeld zu beachten?
Anke Kadereit: Ich würde sagen, die Ausbildung an den Unis und Hochschulen ist nicht sehr spezifisch, aber grundlegend. Sozialpädagogen, die gerade anfangen zu arbeiten, müssen sich schon noch Handwerkszeug draufschaffen.
Praxiskiste: Wie alt sind die Kinder, die in die Frühförderung kommen dürfen?
Anke Kadereit: Wir hatten immer relativ viele sehr kleine Kinder von null bis zwei, die zum Beispiel eine extreme Frühgeburtlichkeit aufweisen. Das war gefühlt ein Drittel oder Viertel der Kinder. Dann kommt ein großer Schwung Kinder im Alter von drei bis vier Jahren. Sie fallen in der Kita oder beim Kinderarzt auf: die Entwicklung weicht ab, aber ist nicht grundlegend anders. Und dann gibt es noch einen kleineren Teil, der relativ spät kommt. Sie zeigen Richtung Schulfertigkeiten oder in der sozialen Entwicklung Auffälligkeiten.
Praxiskiste: Wie verläuft die Kontaktaufnahme zu den KlientInnen?
Anke Kadereit: Es gibt ein breites Zuweiser-Netz. Die wichtigsten Zuweiser sind die Kinderärzte und die Kitas. Dann gibt es noch ganz viele andere, wie das sozialpädiatrische Zentrum (SPZ), das Jugendamt, neuropädiatrischen Sprechstunden, manchmal Kliniken oder der Bunte Kreis (eine Nachsorgeeinrichtung). Außerdem gibt es auch einen kleinen Teil Eltern, die sich aus Eigeninitiative melden.
Praxiskiste: Gibt es (typische) häufig gestellte Diagnosen? Welche sind das?
Anke Kadereit: Ein ganz großer Schwerpunkt sind Sprachentwicklungsstörungen. Dann allgemeine Entwicklungsverzögerungen, also wenn die Kinder einen Entwicklungsrückstand haben, aber noch nicht im Bereich einer klassischen geistigen Behinderung liegen. Außerdem gibt es viele Kinder mit Verhaltensauffälligkeiten, diese kriegen eine Diagnose Störung des Sozialverhaltens und/oder der Emotionen. Außerdem gibt es in den letzten zehn Jahren eine deutliche Zunahme von Kindern im Autismus-Spektrum, bei der sich alle fragen, woran das liegt. Und das kann man nicht nur damit erklären, dass jetzt genauer hingeschaut und die Diagnose weiter gefasst wird. Dann haben wir noch einen kleineren Anteil Kinder mit klassischen Diagnosen, wie Behinderungen, also ein Syndrom liegt vor oder eine extreme Frühgeburtlichkeit, die mit einer Beeinträchtigung einhergeht. Das sind die klassischen großen Gruppen würde ich sagen.
Praxiskiste: Und was sind Sonderfälle, die eher selten auftreten?
Anke Kadereit: Sonderfälle, bei denen nicht klar ist, ob sie für die Frühförderung bestimmt sind oder nicht, sind zum Beispiel Kinder, die aus belasteten Familien kommen. Entweder weil die Eltern erkrankt sind, eine Behinderung haben oder psychisch krank sind. Natürlich sind die Kinder die Symptomträger und zeigen dann auch Beeinträchtigungen, zum Beispiel in der Sprachentwicklung, im Sozialverhalten oder in der emotionalen Entwicklung. Die Frage ist dann jedoch, inwieweit es in diesen Fällen eine individuelle Behandlung braucht oder wie man das System unterstützen kann und durch welche Institution diese Maßnahme geleistet werden sollte.
Praxiskiste: Gibt es noch weitere Sonderfälle?
Anke Kadereit: Eine zweite Gruppe, die mir auch gerade Sorgen macht, sind die Kinder, die in dem Kita-System nicht richtig zurechtkommen. Die haben eigentlich von dem, was man in einer überblicksartigen psychologischen Diagnostik feststellen kann, keine großen Auffälligkeiten, aber in der Kita-Gruppe gibt es Schwierigkeiten. Da ist auch unklar, ob man ihnen eine individuelle Diagnose anhängen kann oder ob man eher sagen muss, da scheint das System Kita eine Reihe von Kindern zu überfordern.
Praxiskiste: Ab wann wird ersichtlich, ob es sich um eine Entwicklungsverzögerung handelt oder dann doch etwas Lebenslängliches?
Anke Kadereit: Wir haben eine Gruppe Kinder, die haben eine Grunderkrankung. Bei diesen Kindern steht von Anfang an fest, dass sie aufgrund eines Syndrom einen abweichenden Entwicklungsverlauf haben werden.
Praxiskiste: Und welche Gruppen gibt es noch?
Anke Kadereit: Und dann haben wir eine zweite Gruppe von Kindern, bei denen relativ zu Beginn auffällt, dass die Entwicklung sehr deutlich von dem abweicht, was wir erwarten. Wir sind vielleicht die erste Anlaufstelle, aber wir sehen sofort, dass dieses Kind nicht innerhalb der zwei, drei Jahre, die es Frühförderung bekommt, aufholen wird. Da sprechen wir relativ bald mit den Eltern und sagen, liegt da vielleicht noch was Grundlegendes dahinter? Da braucht es das medizinische System dazu, das die Eltern beraten kann.
Praxiskiste: Gibt es auch Gruppen, bei denen die Behinderung nicht eindeutig erkennbar ist?
Anke Kadereit: Wir haben noch ein dritte Gruppe, die gar nicht so klein ist. Das sind eine Reihe von Kindern, bei denen wir sagen, da liegt insgesamt eine Entwicklungsverzögerung vor. Nach Möglichkeit haben wir das mit einem IQ-Test gemessen. Wir beginnen mit einer Förderung, wiederholen nach eineinhalb oder zwei Jahren diesen IQ-Test und sehen, dass da kaum Entwicklung passiert ist. Da kommen wir aber schon Richtung Schule und in diesem Alter endet bald die Frühförderung bei uns. Wir sprechen noch einmal mit den Eltern und sagen, das Kind liegt im Moment im Bereich einer geistigen Behinderung und wir würden eine Vorstellung bei einem SPZ oder spezialisierten Kinderarzt empfehlen, um sich beraten zu lassen.
Praxiskiste: Welche Entwicklung würdest du dir für den Bereich der Frühförderung noch in Zukunft wünschen?
Anke Kadereit: Es geht ja gerade Richtung inklusive Kinder- und Jugendhilfe, also was bisher Eingliederungshilfe war, wandert rüber in das Gesamtsystem Kinder- und Jugendhilfe, die inklusiv ausgerichtet werden soll und dadurch sollen sich auch die Kostenträger ändern. Was ich mir in diesem Zuge wünschen würde, wäre, dass man ein breiteres und differenzierteres System aufmacht. Also, dass nicht entweder das Kind Förderung nach dem System wie bisher – Heilpädagogik plus eine medizinische Therapie oder zwei – kriegt, sondern dass man differenzierter darauf blicken kann.
Praxiskiste: Gibt es eine bestimmte Gruppe Kinder, an die du dabei denkst?
Anke Kadereit: Also bei den Kinder, die in der Kita nicht zurechtkommen oder aus einer belasteten familiären Situation kommen, gibt es Ideen, heilpädagogische Familienhilfe anzubieten, also Familienhilfe, die eher auf die Entwicklungsbedürfnisse des Kindes ausgerichtet und dabei eng an den Familien dran ist. Ich fände es schön, wenn man das System breiter fassen würde und individueller Angebote bieten könnte, die nicht so starr an den bisherigen Leistungskatalog gebunden sind.