
Kuratieren – Regie führen im Museum
Es ist ein grauer Novembertag. Am Bahnhof in Stuttgart warten einige Reisende in der Kälte auf den verspäteten Zug. Eine unerwartet gute Gelegenheit für interessante Begegnungen.
Bei einer Zigarette lernen wir so Dr. Sabine Maria Schmidt kennen. Sie ist unterwegs nach Tübingen zum Aufbau ihrer neuen Ausstellung in der Kunsthalle. Schmidt, die 1968 bei Osnabrück geboren wurde, arbeitet als freie Kuratorin, Autorin und Kritikerin. Ihr Schwerpunkt liegt dabei auf zeitgenössischer Kunst, neuen Medien und der Kunst der Klassischen Moderne. Zur Eröffnung von »Korpys/Löffler: PERSONEN, INSTITUTIONEN, OBJEKTE, SACHEN« lud sie uns kurzerhand ein. Wie man Kuratorin wird und was den Beruf besonders macht, hat sie uns bei einer Tasse Kaffee in der Kunsthalle Tübingen erzählt.
Praxiskiste: Der Beruf des Kurators liegt gerade voll im Trend. Hat sich in den letzten Jahren etwas verändert?
Sabine Schmidt: Ich bin mit der Vorstellung aufgewachsen, dass die Beschäftigung mit Bildender Kunst, mit Musik und Literatur den Menschen feinsinniger macht und zum komplexeren Denken anregt. Der Wunsch und das Bedürfnis nach Kultur bewegen einen. Vieles hat aber an Wertschätzung verloren, weil es selbstverständlich geworden ist. Das Berufsfeld selbst hat sich stark gewandelt. Heute wird so gut wie alles kuratiert – selbst die Schinkenplatte mit Spargel. Dabei gibt es ein Auseinanderdriften im Berufsverständnis. Auf der einen Seite steht das Image des globalen und einflussreichen Super-Kurators im Kunstbetrieb, der alle Fäden in der Hand hat. Meistens ist die Tätigkeit des Kurators aber viel weniger spektakulär. Denn der Kurator ist nicht zuletzt auch ein Dienstleister, der für vieles seinen Kopf hinhalten muss.
Sie haben Germanistik, Kunstgeschichte und Musikwissenschaft studiert. Wollten Sie schon immer Kuratorin werden?
Für die Fächer habe ich mich entschieden, weil ich sehr viel Musik gemacht, gern diskutiert und geschrieben habe. Eigentlich wollte ich Schriftstellerin werden, kam durch das Studium in Münster aber mehr zur Kunst. Das Institut für Kunstgeschichte dort hatte ein klassisches Curriculum, ich musste also auch Referate zur höfischen Kultur im Mittelalter machen. Aber mich hat natürlich interessiert, was aktuell passiert. Zum Glück gab es in Münster eine sehr lebendige Kunstszene, mit der ich durch verschiedene Projekte in Berührung kam. Außerdem habe ich angefangen für verschiedene Stadtmagazine zu schreiben, habe auch Radio und Fernsehen gemacht. Dabei wurde mir aber schnell klar, dass mir die Formate dort zu begrenzt sind. Also habe ich mich für das Museum entschieden.
Bedeutete das auch damals schon Volontariat und Promotion?
Ja! Für einen Einstieg in das Museum war eine Promotion unerlässlich. Ich hatte Glück und konnte sehr früh schon sehr viel machen. Mit 25 habe ich schon meine ersten Ausstellungen kuratiert.
Seit einigen Jahren kann man kuratieren studieren. Wie bewerten Sie diesen Wandel?
Ich habe ja noch ganz klassisch Geisteswissenschaften studiert. Weil ich neben dem Studium noch Geld verdienen musste, hatte ich ein straffes Programm. Aber der Ablauf war trotzdem nicht so stark getaktet wie heute der Bachelor. Es gab etwas mehr Zeit, mehr Spielräume, eine andere Studienkultur, die nicht so stark auf Effizienz, sondern Erkenntnisgewinn ausgerichtet war. Das hat sich heute verändert, weil Studiengänge sich mehr an beruflichen Perspektiven orientieren und Geisteswissenschaften zum Beispiel mit Management oder BWL kombiniert werden. Wenn man sich spezialisieren will, muss man genau wissen, was man will. Spezifische Programme wie »curatorial studies« sind ja erst in den späten 1990er Jahren entstanden, genau wie der Beruf des Kurators an sich. Vorher musste man sich zwischen Museum, Galerie und Presse entscheiden – alles gleichzeitig war undenkbar und wurde als geistige Korruption angesehen. Heute ist es anders geworden. Allerdings führt es auch zu einer Verwischung der Grenzen, weil alle alles machen. Das hindert leider viele daran Haltung zu beziehen und Mut zu haben, etwas zu wagen.
Und Mut braucht es auch für den Schritt in die Freiberuflichkeit. Was waren Ihre Gründe selbstständig zu werden?
Ich würde sagen, das hat sich so ergeben – wie vieles im Leben. Freiberuflich bin ich jetzt seit drei oder vier Jahren und genieße es, wobei es finanziell natürlich sehr schwierig ist. Deshalb ist es notwendig, sich ganz anders zu positionieren, sich zu vernetzen und zu fragen, wo ich mein Wissen sinnvoll einbringen kann. Man muss flexibel sein in diesem Beruf und ich denke, auch bei mir wird sich in den kommenden Jahren noch einiges ändern. Es kommen immer neue Herausforderungen dazu und man lernt ständig Neues. Zum Beispiel weiß ich eigentlich gar nicht, was Projektmanagement bedeutet und trotzdem mache ich ein Projekt nach dem anderen.
Da Sie jetzt das Thema Projekte ansprechen – wie gehen Sie typischerweise bei der Planung eines solchen Ausstellungsprojektes vor?
Die Rahmenbedingungen sind für jedes Projekt natürlich immer ein bisschen anders. Aber die wichtigste Aufgabe als angestellte Kuratorin in einem Museum ist erst einmal die konzeptionelle Entwicklung der Ausstellung, die zur zugehörigen Institution und zum geistigen Konzept des Hauses passen muss. Dann müssen Direktor*in und Kolleg*innen überzeugt werden. Im nächsten Schritt geht es darum, Gelder zusammen zu bekommen. Manchmal gibt es diese aus dem Jahresbudget, in den meisten Fällen muss man aber Extra-Gelder akquirieren. Erst dann kann ich anfangen Künstler einzuladen und die Ausstellung ansich zu organisieren. Als freiberufliche Kuratorin bekommt man auf unterschiedlichen Wegen Aufträge. Eine Ausstellung in Danzig habe ich zum Beispiel mithilfe von Kontakten selbst initiiert. Weil ich schon eine Weile in diesem Beruf unterwegs und dadurch bekannt bin, bekomme ich aber auch Anfragen von Institutionen oder Künstlern.
Ihre aktuelle Ausstellung »Personen, Institutionen, Objekte, Sachen« geht auf Deutschlandtour. Jedes Museum ist aber architektonisch anders. Welchen Einfluss hat das auf ein Ausstellungskonzept?
Ja, es gibt noch zwei weitere Stationen. Anfang März 2018 eröffnet die Ausstellung im Kunstverein Braunschweig und Mitte 2018 dann im Hartware MedienKunstVerein Dortmund. Wir haben zwar ein stringentes Ausstellunsgskonzept, aber Sie haben natürlich Recht: Die Inszenierung von Installationen wird immer durch die Räumlichkeiten und Konzepte des jeweiligen Ortes geformt und gestaltet. Dadurch wird alles neu interpretierbar und die großen Installationen hier in Tübingen machen in Braunschweig oder Dortmund zum Beispiel weniger Sinn. Deshalb muss man die Ausstellung entsprechend anpassen und es ergibt sich ein anderer großer Werkkomplex. Bei Videoinstallationen ist außerdem das Problem, dass man sie auf diese Weise nicht im Kino zeigen kann. Ich habe immer gehofft, dass Kinos in Zukunft so etwas möglich machen, aber leider ist das bislang nicht passiert. Für Tübingen haben die Künstler Korpys/Löffler zudem spezifische Arbeiten entwickelt, darunter die Rekonstruktion einer »Konspirativen Wohnung«, die eine enge historische Anbindung an die Stadt hat. Für die anderen Orte werden sie andere Schwerpunkte setzen.
Mit dem deutschen Künstlerduo Korpys/Löffler haben Sie 2004 das erste Mal zusammengearbeitet. Auch jetzt, bei der Ausstellung in Tübingen, sind die beiden dabei. Unter welchen Aspekten wählen Sie die Künstler und insbesondere die jeweiligen Werke aus?
In Tübingen bin ich eingeladen worden, als Gastkuratorin das bereits konzipierte Projekt zu realisieren, da ich ihr Werk schon seit vielen Jahren kenne und verfolge. Grundsätzlich arbeite ich gerne mit Künstlern zusammen, die eine besondere Haltung zur Kunst und ihrer gesellschaftlichen Verortung haben. Zudem entdecke und schreibe ich aber auch bevorzugt über Künstler, deren Werk mich intuitiv fasziniert und das ich intensiv verstehen möchte.
Eine letzte Sache noch, was macht für Sie den Beruf des Kurators aus?
Kuratorin ist einer der schönsten Berufe überhaupt, weil er so vielfältig ist. Es kommt immer darauf an, mit welchem Ethos man an den Beruf herangeht. Ich hätte keine Motivation dafür, wenn ich Kunst »verwalten« oder unter Marketing-Aspekten verhandeln müsste. So kümmere ich mich um ein Projekt und versuche im Interesse verschiedener Akteure etwas Besonderes zu entwickeln. Das kann man vielleicht mit der Arbeit eines Regisseurs vergleichen. Ganz nah dran zu sein am Künstler und am Publikum, zusammen mit der inhaltlichen Konzeption einer Ausstellung, macht für mich Kuratorinsein zu einem Traumberuf. Persönlich liebe ich meine Arbeit auch deshalb, weil sie mich immer wieder herausfordert und ich mich dadurch weiterentwickeln kann. Selbst mit 70 Jahren – oder falls ich jemals älter werden sollte –werde ich noch neue Dinge und Themen entdecken.
Doch darf man auch nicht unterschätzen, wie arbeitsintensiv diese Tätigkeit ist. Denn hinter den Kulissen passiert weit mehr, als man denkt. Aber am Schluss muss der Besucher in ein Haus kommen, eine Ausstellung sehen und den Eindruck haben, das alles hätte gar keine Arbeit gemacht.
Die Ausstellung »PERSONEN, INSTITUTIONEN, OBJEKTE, SACHEN« ist noch bis zum 18.
Februar 2018 in der Tübinger Kunsthalle zu sehen. www.kunsthalle-tuebingen.de
Weitere Informationen zu Dr. Sabine Maria Schmidt unter: www.sabinemariaschmidt.com
Das Interview entstand in einem Master-Seminar der Medienwissenschaft an der Universität Tübingen unter der Leitung von Dr. Anne Ulrich.
Ein Projekt von Laura Bartusch, Jasmin Bühner, Anne Diessner und Alexandra Gracev.
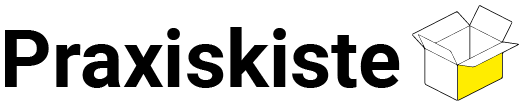
Noch keine Kommentare