
»Wer gut ist, hat echt eine Chance«
Tageszeitungen sind tot. Journalismus ist eine aussterbende, brotlose Kunst. Dr. Gernot Stegert, Chefredakteur des Schwäbischen Tagblatts, erklärt im Interview mit Johannes Wacha, warum die Wahrheit anders aussieht – und wie der perfekte Bewerber sich zu verhalten hat.
Praxiskiste: Herr Stegert, Ihr Sohn sagt Ihnen heute, dass er Journalist werden will. Was antworten Sie ihm?
Stegert: Ich frage ihn: »Hättest du daran Spaß?«. Spaß meine ich nicht im oberflächlichen Sinne. Journalismus müsste vielmehr etwas sein, was seinen Talenten entspricht. Etwas, das er langfristig machen will. Er müsste für sich herausfinden, ob das sein Ding ist, um nicht das überhöhte Wort Berufung zu verwenden. Und wenn das so ist, dann wird er einen Weg finden, sich durchzuboxen. Das ist im Journalismus genau so, wie in anderen Jobs auch. Aber die Rahmenbedingungen sind sicher nicht mehr so gut wie vor dreißig Jahren.
Sie haben 1990/91 bei der Lübecker Zeitung volontiert, davor Germanistik und evangelische Theologie in Tübingen studiert. War Ihr heimlicher Traumberuf Pfarrer?
Nein, auf keinen Fall. Ich bin Christ und wollte an der Uni einfach durchdenken, was mich persönlich beschäftigt. Das Hauptfach war ganz klar Germanistik. Ich habe mich schon immer für Literatur interessiert und bin dann über die Linguistik bei der Medienwissenschaft gelandet.
Das Germanistikstudium steht heute für viele an der Spitze der Liste brotloser Künste. Wolf Schneider, der lange Jahre Journalistenausbilder an der Henri-Nannen-Schule war, hat einmal gesagt: »Germanistik gehört zusammen mit Soziologie, Psychologie und Kommunikationswissenschaften, zu den Fächern, von denen ich dringend abrate — denen, die Journalisten werden wollen.« Als Germanistikstudent und Chefredakteur, was entgegnen Sie Herrn Schneider?
Schneider warnt in seinen Lehrbüchern vor Pauschalurteilen. Ich glaube, er erliegt hier selbst einem. Ich verstehe ihn so, dass die Studierenden durch den Wissenschaftsjargon sprachlich verhunzt werden. Da würde ich die Liste der Fächer aber noch deutlich erweitern. Eins der schlimmsten Fächer ist Jura – was die Juristen mit der deutschen Sprache anstellen, sollte selbst unter Strafe stehen.
Schlechte Aussichten für Germanisten also?
Nein, gar nicht. Es kommt immer darauf an, was man daraus macht. Und das ist in allen Wissenschaften so: Man kann sie fürchterlich betreiben, aber auch mit wachem Auge und großem Interesse für die Gesellschaft. In der Germanistik lernt man, gezielt zu lesen und zu verstehen. Und das sind Schlüsselqualifikationen, die aus dem Alltag eines guten Journalisten nicht wegzudenken sind.
Aber hat ein Absolvent mit konkretem Fachstudium, sagen wir Wirtschaftsrecht, Vorteile gegenüber dem, der bloß die Geisteswissenschaft studiert hat?
Jein. Einerseits verstehe ich, was Schneider meint: Je mehr Wissen, desto besser. Manchmal habe ich mir selbst während meines Studiums schon Fachkenntnisse in einem bestimmten Bereich gewünscht. Auf der anderen Seite sollen, ja, müssen wir Universaldilettanten sein. Eine ganz wichtige journalistische Aufgabe besteht darin, sich jedes Mal neu einzuarbeiten. Ein komplexes Thema für uninformierte Leser zu übersetzen. Das ist Spaß und Qual zugleich.
Wer zum Experten wird, läuft schnell Gefahr, diese Übersetzungsleistung nicht mehr zu schaffen. Als Journalist informiere ich mich ja stellvertretend für die Leser. Und da darf — und soll — ich auch erstmal die blöden Fragen stellen. Bei unseren Praktikanten und Volontären gilt das auch: Das Studienfach ist fast nie ausschlaggebend. Was zählt, sind praktische Erfahrungen. Das Gefühl für die Themen kommt meist erst mit der Zeit.
Warum hat es Sie eigentlich in den Print-Journalismus gezogen – war das für Sie ein Traumberuf?
Nein, nicht so wie Polizist oder Feuerwehrmann für manche Jungen. Aber es war früh eine Perspektive. Spätestens nach dem Abi wusste ich, wo es hingeht. TV und Radio habe ich in der Ausbildung auch versucht, aber da textet man eben auf O-Töne und Bilder. Das ist mit richtigen Volltexten nicht zu vergleichen. Da kommt meine lange zurückliegende Liebe zum Schreiben durch. Wenig ist befriedigender, als einen schönen, runden Text zu schreiben. Eine Reportage, oder einen Leitartikel. Da kann man sich sprachlich so richtig austoben, das liebe ich. Außerdem habe ich mich auch sehr an den Tagesrhythmus gewöhnt.
Der kann in einer Tageszeitung aber auch sehr stressig sein.
Auf jeden Fall, das ist einer der Stressfaktoren des Berufs. Ganz besonders bei den Tageszeitungen. Jeder Tag bringt Überraschendes, und man muss aktuell reagieren. In Absprache mit dem Druckhaus kann der Arbeitstag da schon mal bis Zwölf gehen. Das ist aber die absolute Ausnahme. Ich vergleiche es immer mit dem Laufen, was ich in meiner Freizeit sehr gerne mache: Wenn man dann spät am Abend noch eine Neuigkeit in einen runden Bericht verpackt, ist man zwar anschließend k.o., aber hochzufrieden, dass man es geschafft hat – wie bei einem Marathon. Das befriedigt unglaublich.
Versuchen Sie, Ihren Berufsalltag als Chefredakteur einmal ganz knapp zu umreißen. Wie sieht ein normaler Tag aus?
Am Morgen sortiere ich die aktuellen Themen und lege mit dem Blattplaner Umfang und Inhalte für den nächsten Tag fest. Um 12 Uhr haben wir unsere tägliche Redaktionskonferenz mit Blattkritik und Planung der neuen Ausgabe. Um 17:45 werfen wir einen Kontrollblick auf die Seiten, soweit sie fertig sind. Dazu kommen Besprechungen im Haus, etwa mit der Geschäftsführung und Marketingabteilung — so genau kann man das nicht festmachen. Und dann habe ich eigene Themen, über die ich schreibe: Wirtschaft und Kommunalpolitik.
Sie lieben das Schreiben. Wie viel Redakteur steckt eigentlich noch im Chefredakteur?
Ich habe das große Glück, viel selbst zu schreiben. Das ist aber nicht der Normalfall. Ich höre auf Kongressen und Tagungen immer wieder, dass die meisten Kollegen sehr stark auf Organisation und Management beschränkt sind. Doch die Leser erwarten, dass der Chefredakteur im Blatt präsent ist. Alle Redakteure sind auch Gesichter des Tagblatts. Mein Gesicht und mein Name ganz besonders — die Leute verbinden mich damit. Es kommt vor, dass ich auf der Straße angesprochen oder in den Leserbriefen für Kommentare geprügelt werde. Aber das ist auch eine Art der Bindung, und ist auch gut so. Schlimm wäre, wenn sie sagen würden »is’ mir egal«.
Herr Stegert, sprechen wir über den Berufseinstieg. Bei vielen angehenden Journalisten wird das Interesse von der Angst überschattet, auf der Bank der unterbezahlten, ewig freien Redakteure zu landen. Und das auch nur, wenn man einen der hart umkämpften Volontariatsplätze ergattert. Ist diese Angst realistisch?
Nein. Nicht in diesem Ausmaß. Eher umgekehrt: Die Chancen für Bewerber auf Volontariate sind aus zwei Gründen deutlich gestiegen. Zum einen sinken die Bewerberzahlen. Als ich vor sechs Jahren hier in Tübingen angefangen habe, hatten wir über einhundert Bewerbungen auf vier Plätze, inzwischen sind wir bei unter vierzig. Zum anderen steigen die Chancen für ernsthafte Kandidaten, weil immer mehr Bewerbungen gleich beiseite gelegt werden müssen. Wer keine einzige Arbeitsprobe beilegen kann, sollte sich für ein Praktikum und nicht für ein Volontariat bewerben. Solche Fälle gibt es tatsächlich. Praktika dauern bei uns einen Monat. Da bekommt man eine faire Chance, sich in verschiedenen Gebieten auszuprobieren. Natürlich sind am Anfang sehr einfache Termine dabei, um zu schauen, um zu schauen, was der Praktikant kann. Wenn es sich bewährt, werden die Themen schnell komplexer. Zwei von unseren vier aktuellen Volontären sind durch ein Praktikum reingekommen. Ich kann nur ganz klar sagen: Wer gut ist, hat echt eine Chance.
Wer ist eigentlich gut? Können Sie ganz stichwortartig drei unverzichtbare Eigenschaften nennen?
Das ist einfach: Neugier, Neugier, Neugier. Und wenn Sie noch mehr wollen: Offenheit für Menschen und verschiedenste Lebenswelten, Differenzierungsvermögen und ein kritischer Blick, Sorgfalt und Genauigkeit, Sprachgefühl und zunehmend multimediale Kenntnisse.
Ich wollte Sie fragen, was der perfekte Tagblatt-Praktikant mitbringen muss. Lassen Sie mich raten: Neugier?
Aber ganz sicher! Er muss zeigen, dass er die Perspektive der Leser findet und sie versteht. Viele orientieren sich bei Terminen zu sehr am Veranstalter. Man muss sich immer wieder fragen: Was ist für die Leser interessant? Das gehört dann dick und groß an den Anfang. Das darf nicht im Text untergehen.
Als angehender Journalist sollte ich unbedingt…
… immer geradeaus auf Menschen zugehen. Das musste ich selbst lernen. Ich war am Anfang eher schüchtern und musste Scheu abbauen. Es lohnt sich, immer freundlich aber bestimmt auf Menschen zuzugehen. Außerdem sollte man sich auf keinen Fall scheuen, Fragen zu stellen. Egal, wie offensichtlich sie erscheinen. Hier Hemmungen zu haben, ist absolut schädlich.
Sie zeichnen ein beruhigendes Bild für Bewerber. Realität ist aber auch, dass die junge Generation das Interesse für Tageszeitungen verloren hat. Die Auflagen sprechen eine deutliche Sprache. Wer hat hier wen verloren?
Da haben wir es auf jeden Fall mit einem Versäumnis der Verlage zu tun. Und das wissen wir auch — das ist eingestanden. Die haben in den Neunzigerjahren einen entscheidenden Fehler gemacht: Sie haben ihre Inhalte frei ins Netz gestellt. Die Erwartungshaltung ist also, ich kann alles frei lesen und muss für nichts bezahlen. Das wieder einzuholen, ist unglaublich schwer. Dazu wird momentan auf ganz vielen Kongressen diskutiert, aber letztendlich sind das natürlich alles Blicke in die Glaskugel. Hätte einer den Stein der Weisen gefunden, wären alle anderen schon aufgesprungen. Ich glaube aber auf alle Fälle, dass es einen gesellschaftlichen Bedarf an Journalismus gibt, und damit auch an Tageszeitungen. In welcher Form auch immer. Ein Kollege sagte einmal, Zeitungen verkaufen kein Altpapier, sondern Information. Wo wir gelesen, geschaut und gehört werden, ist letztendlich egal. Was momentan fehlt, ist ein funktionierendes Bezahlmodell.
Trotz der Schwierigkeiten scheinen Sie Ihren Beruf zu lieben. Liegt das auch an Tübingen? Ob als Lehrbeauftragter, als Student oder als Chefredakteur, irgendetwas scheint Sie ja immer wieder zurückzuziehen.
Auf jeden Fall. Die Stadt ist einfach faszinierend. Am besten lässt sich das mit Walter Jens’ Buchtitel »Die kleine große Stadt« beschreiben. Wenn ich mit Kollegen spreche, werden die immer ein bisschen neidisch. Manche arbeiten in viel größeren Städten, die aber todlangweilig sind. Tübingen bietet unglaublich viel: Weltoffenheit, Veranstaltungen mit Gästen aus aller Welt, Studierende wie Prominente. Die Uni spielt dabei natürlich eine ganz wichtige Rolle. Dadurch erlebe ich immer wieder: es ist eine Weltstadt. Und umgekehrt ist es auch ein Dorf. Jeder kennt jeden. Die Leute, mit denen ich beruflich zu tun habe, sei es wirtschaftlich oder kommunalpolitisch, kennen sich alle irgendwie. Beides zusammen ist sehr faszinierend.
Herr Stegert, vielen Dank für das aufschlussreiche Gespräch.
Dr. Gernot Stegert
Dr. Gernot Stegert studierte Germanistik und evangelische Theologie in Tübingen und war schon während seiner Studienzeit als wissenschaftliche Hilfskraft und freier Mitarbeiter bei verschiedenen Zeitungen tätig. Nach seinem Volontariat bei den Lübecker Nachrichten war er als Lokal- und Politikredakteur tätig und promovierte 1996 mit einer Studie zum Kulturjournalismus in der Presse. Bereits 1993 erschien sein Handbuch „Filme rezensieren in Presse, Radio und Fernsehen“.
Seit 2012 ist er Chefredakteur beim Schwäbischen Tagblatt.
Zur Person
Johannes Wacha studiert Medienwissenschaft und Anglistik in Tübingen. Wenn er nicht gerade schläft oder schriftlich seinem Frust über die neuen Star-Wars-Filme freien Lauf lässt (Früher war alles besser!), schreibt er über Film, Fernsehen, Politik und die Welt des E-Sports.
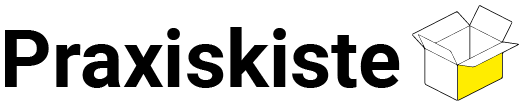
Noch keine Kommentare